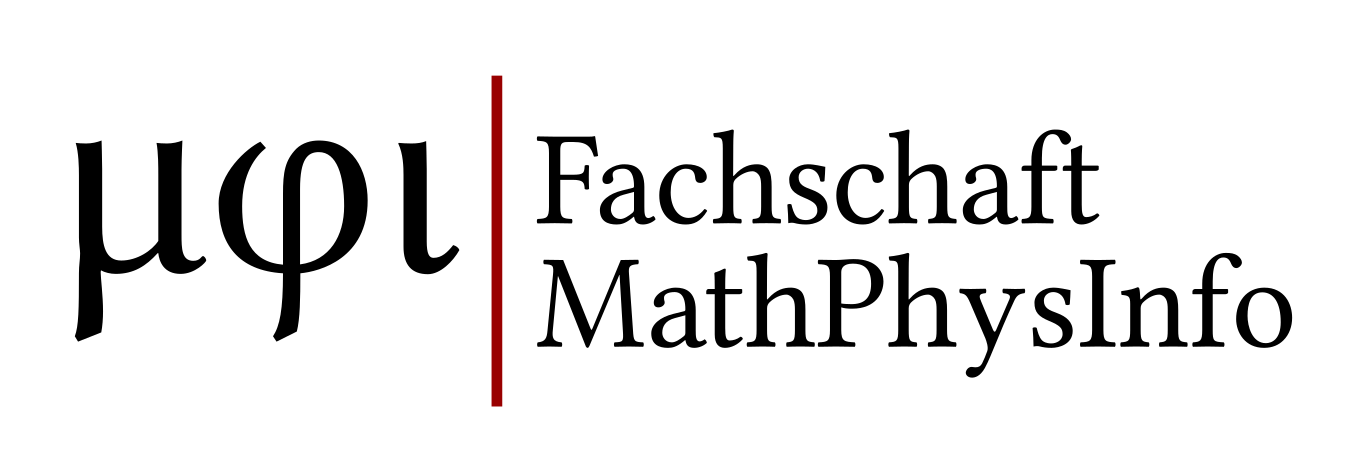Der StuRa ist das zentrale legislative Organ der VS. Seine Mitglieder bestehen sowohl aus entsendeten Fachschaftsvertretern als auch aus von Studierenden direkt gewählten Listenkandidaten.
Die RefKonf, welche früher als „AStA“ (Allgemeiner Studierendenausschuss) bekannt war, wird vom StuRa gewählt und gliedert sich in 2 Vorsitzende, die Beschlüsse des StuRa ausführenden Referate und autonome Referate, welche die Selbstvertretung benachteiligter Studierender wahrnehmen.
Das zur Einführung der VS beschlossene Gesetz bietet eine sichere Grundlage für manche Aspekte studentischer Interessenvertretung, bleibt jedoch an vielen Punkten hinter den Forderungen der Landesstudierendenvertretung BaWü zurück. Zum Beispiel schränkt es Kompetenzen in Bereichen, die auch von den Studentenwerken wahrgenommen werden, politische Äußerungen sowie die Geschäftsfähigkeit der Verfassten Studierendenschaft ein. Zudem sieht es dreimal so viele Finanzkontrollen wie in jedem anderen Bundesland vor.
Im Folgenden sind neben einer allgemeinen Erläuterung der aktuellen und bisherigen Situation in Baden-Württemberg die Gremien, die Auswirkungen auf die Rechtsfähigkeit, die Selbstorganisation, die Studienbeiträge, die Finanzverwaltung und das Mandat der Studierenden kurz dargestellt. Weiter unten findet ihr außerdem Infos zur Geschichte der Verfassten Studierendenschaft bis 1977 und der Unabhängigen Modelle 1977-2012.
Weitere Informationen zur VS gibt es u.a. auf der Website des Studierendenrates. Den Gesetzestext des VerfStudG findet ihr auf der Seite des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Eine äußerst ausführliche Kommentierung des Gesetzes findet sich auf der landesweiten Seite zur VS.
Wenn ihr Fragen zur Bedeutung des Gesetzes habt, wendet euch an fachschaft@mathphys.fsk.uni-heidelberg.de
Wiedereinführung 2012/13
In Baden-Württemberg gab es schon einmal eine VS, die jedoch 1977 sicherheitshalber wieder abgeschafft wurde, um die Studierenden vor politischen Dummheiten zu bewahren. Stattdessen richtete man einen rein beratenden Senatsausschuss unter Rechtsaufsicht des Rektors ein, den man einfach genauso wie die bisherige Studierendenvertretung als „AStA“ bezeichnete. Dieser durfte weder zu Fragen des Studiums, noch zu Problemen einzelner Fachbereiche oder politischen Fragen (z.B. BAföG oder Semesterticket) aktiv werden.
Daraufhin schufen die Studierenden parallel zum „AStA“ ihre eigene Vertretung, die als unabhängige Gremien bezeichnet wurden. Um sich vor Ort für die Belange der Studierenden eines Fachbereichs einzusetzen, legitimierten sich u.a. unabhängige Fachschaften und Institutsgruppen durch öffentliche Treffen und bildeten mit der „Fachschaftskonferenz“ (FSK) einen universitätsweiten Zusammenschluss.
In den Fächern Mathematik, Physik und Informatik übernimmt diese Aufgabe seit 1983 die Fachschaft MathPhys. Im Zuge der Einführung der VS hat der Zusammenschluss MathPhys sich formal wieder in die drei Teilfachschaften Mathematik, Physik und Informatik aufgeteilt.
Nach der Wiedereinführung der VS haben die Studierenden am 13. bis 15. Mai 2013 per Urabstimmung über die Struktur der VS abgestimmt. Dabei standen zwei Modelle zur Auswahl:
- der Studierendenrat (StuRa) – ein Modell mit nur einer Kammer
- das Zweikammernmodell: Studierendenparlament (StuPa) und Fachschaftskonferenz (FSK)
Während unsere Fachschaft einen Konsens für das Zweikammernmodell gefunden hatte, hat sich bei der Urabstimmung die Mehrheit der Studierenden mit 58.87% für das StuRa-Modell ausgesprochen.
Alle Studierenden sind qua Immatrikulation automatisch Mitglied der Verfassten Studierendenschaft. Weil sie die einzige Möglichkeit zur Partizipation an legitimierter Studierendenvertretung ist und ihre Leistungen für alle Studierenden offen stehen müssen, ist ein Austritt nicht möglich.
Die Gremien der VS
Die Heidelberger VS wird sich in sog. Studienfachschaften gliedern. Diese umfasst alle Studierenden eines Fachs – in eurem Fall also Mathematik, Physik oder Informatik. Auf Ebene der Studienfachschaften wird es zwei Organe geben:
- die Vollversammlung
- einen gewählten „Fachschaftsrat“
In den Fachschaften Mathematik, Physik und Informatik haben wir uns dafür entschieden, den Fachschaftsrat als lediglich ausführendes Organ zu gestalten – die Entscheidungskompetenzen liegen bei der regelmäßig stattfindenden Vollversammlung, der „Fachschaftssitzung“. Ihr könnt also, ohne euch extra wählen lassen zu müssen, jederzeit auf Fachschaftsebene mitarbeiten und mitentscheiden.
Eine oder mehrere Studienfachschaften werden formal wiederum zu Fakultätsfachschaften gezählt (z.B. die Studienfachschaften Mathematik und Informatik zur Fakultätsfachschaft Mathematik und Informatik).
Auf zentraler (fachübergreifender) Ebene wird es nur ein einziges legislatives Organ der Studierendenschaft geben: den StuRa.
Er beschließt über alle zentralen Belange der Studierendenschaft (Höhe der Beiträge, finanzen, Wahl der Referate, etc.) und besteht aus VertreterInnen aller Studienfachschaften, die von diesen entsandt werden (64 Personen) sowie aus direkt durch die Studierenden gewählten Mitgliedern.
Die Anzahl direkt gewählter Mitglieder skaliert mit der Wahlbeteiligung und liegt zwischen 0 Personen (bei 0% Beteiligung) und ebenfalls 64 Personen (bei 50% oder höherer Beteiligung).
Das exekutive Organ der VS wird in Heidelberg die sog. „Referatekonferenz“ (RefKonf) sein. Sie besteht aus vom StuRa für bestimmte Aufgabenbereiche (z.B. Kommunales, Ökologie, Hochschulpolitik, Soziales, …) gewählten ReferentInnen, welche Beschlüsse des StuRa umsetzen und – sofern der StuRa nicht beschlussfähig ist – eigenständig im Namen der Studierendenschaft entscheiden.
Rechtsfähigkeit
Der bisherige „AStA“ ist ein Ausschuss im Gesamtgebilde Universität. Durch die VS wird die Studierendenvertretung (jedoch nur als Ganzes – nicht ihre Organe) zu einer eigenständigen, rechtsfähigen Teilkörperschaft innerhalb der Universität. Dadurch kann sie selbst Verträge abschließen und so z.B. mit den Verkehrsbetrieben direkt über das Semesterticket verhandeln.
Satzungshoheit
Die VS hat sich eine eigene Organisationssatzung gegeben, in der sie die Organe und Zuständigkeiten festhält. Prinzipiell sind die verschiedensten Elemente, von Vollversammlungen über gewählte Fachschaftsräte, entsendete Fachschaftskonferenzen, bis zum gewählten Studierendenparlament oder auch eine Kombination davon möglich.
Das Gesetz macht dazu allerdings einige Vorgaben.
Die Vorgaben des Gesetzes sehen leider auf hochschulweiter Ebene nur drei Möglichkeiten/Kombinationen vor: entweder eine Vollversammlung aller Studierender, zentral gewählte VertreterInnen (Parlamentsmodell), oder entsandte VertreterInnen aus dezentral gewählten Organen (StuRa-Modell). Damit kann das bisherige Heidelberger unabhängige Modell der Studierendenvertretung nicht 1:1 in die VS übernommen werden. Denn offene Fachschaften, die VertreterInnen auf die hochschulweite Ebene entsenden, widersprechen den vertretungsdemokratischen Prämissen des Gesetzes.
Auch die Fachschaften müssen sich konstituieren. Die Satzung der VS sieht hierbei ein Regelmodell vor, falls die Fachschaften keine eigenen Satzungsvorschläge einbringen, welche dann im StuRa beschlossen werden müssen. Über die Satzungen der Studienfachschaften Physik, Mathematik und Informatik haben im Januar 2014 die Studierenden in einer Urabstimmung abgestimmt. Alle Satzungen wurden angenommen und stehen hier zum Download bereit:
Beitragshoheit
Die VS kann von allen Studis Beiträge erheben, die zusammen mit dem sonstigen Semesterbeitrag eingezogen werden. Mit der Einführung der VS wurde leider nicht festgeschrieben, dass das bisherige von der Uni verwaltete Budget des „AStA“, auf das die Studierendenvertretung zurückgreift, bestehen bleibt. Deshalb erhebt die VS einen Beitrag von derzeit 7,50€ pro Semester. Damit wird nicht nur die bisherige Arbeit fortgeführt, sondern auch die Etablierung und Förderung neuer studentischer Projekte, besserer Kampagnen zur Vertretung der studentischen Interessen und mehr Service ermöglicht.
Finanzautonomie
Bisher war die FSK bei sämtlichen Finanzentscheidungen auf den guten Willen der Univerwaltung angewiesen, da die Finanzhoheit bei der Uni und nicht der Studierendenschaft lag. Dies ändert sich nun endlich! Die VS entscheidet über ihr eigenes Geld selbst.
Mandat
Bisher ist der offizielle, sogenannte „AStA“ mit einem sportlichen, kulturellen, musischen und eingeschränkt sozialen Mandat ausgestattet. Mit dem Gesetz erhält die neue VS zusätzlich zu den alten Kompetenzen ein hochschulpolitisches und soziales Mandat; sie darf sich außerdem zum Wirken der Hochschule in der Gesellschaft äußern, z.B. durch Technikfolgenabschätzung, sowie die politische Bildung der Studierenden
fördern. In diesem Sinne hat sie ein politisches Mandat. Dabei ist sie an das übliche Neutralitätsgebot für staatliche Organe mit Pflichtmitgliedschaft gebunden, darf also z.B. keine Werbung für religiöse oder parteipolitische Strukturen machen.
Unsere Gründe für die Unterstützung des StuPa/FSK-Modells:
Als Fachschaft hatten wir vor der Urabstimmung einen Konsens für das StuPa/FSK-Modell gefunden. Hier sind einige der zentralen Überlegungen, die uns dazu geführt haben:
Eine vs. zwei Kammern
Es gibt hauptsächlich zwei Strukturen studentischer Beteiligung:
Die eine ist die Fachschaft. Hier engagieren sich Studierende, deren primäres Interesse darin liegt, auf Fach- und Universitätsebene für bessere Verhältnisse in ihrem Studienfach einzutreten. Kernpunkte der Fachschaftsarbeit können Studien- und Prüfungsordnungen, Struktur- und Entwicklungspläne der Institute, Lehrveranstaltungsplanung, Studienberatung sowie das „Tagesgeschäft“ (z.B. die Vermittlung mit dem Institut/Seminar bzw. Fakultät bei Problemen einzelner Studis).
Die zweite Struktur ist die allgemeine Hochschulgruppe. Hier treffen sich Studierende aller Fachrichtungen, die ein häufig spezielles Interesse zusammenbringt. Beispiele sind die gewerkschaftlichen, parteipolitischen oder sozialen Hochschulgruppen (z.B. „Studieren Ohne Grenzen“ oder die „Amnesty International Hochschulgruppe“). Diese haben einen engeren Fokus als Fachschaften, sind in ihrem jeweiligen „Fachgebiet“ jedoch meist deutlich besser aufgestellt. Themen, die Hochschulgruppen bearbeiten, sind beispielsweise die Frage nach einem Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte oder die Einführung von Ökostrom an der Universität.
Beobachtung zeigt, dass die beschriebenen Interessenslagen häufig disjunkt sind – Fachschaften bearbeiten nur sehr selten Themen wie Tariflöhne oder Energiemanagement, umgekehrt ist uns kein Fall bekannt, in dem eine Hochschulgruppe schon konkrete Prüfungsordnungen bearbeitet oder kommentiert hätte.
Was die studentische Selbstverwaltung angeht, steht den beiden Strukturen eine natürliche Gliederung der Interessensvertretung innerhalb der Universität gegenüber:
Auf der einen Seite liegt der Komplex der sog. akademischen Selbstverwaltung – also die Arbeit in den inneruniversitären Gremien wie Fakultätsrat/Studienkommission, Senat oder Fachrat. Insbesondere bei den dezentralen Organen liegt die inhaltliche Kompetenz eindeutig auf Seiten der Fachschaften. Demgegenüber liegt der Bereich der gemeinsamen politischen Willensbildung innerhalb der Studierendenschaft insbesondere zu allgemeinpolitischen Themen mit Hochschulbezug, der mit der VS nochmals ausgeweitet wurde. Dort liegt die Kompetenz eher bei den zuvor beschriebenen Hochschulgruppen.
Dieses natürliche Nebeneinander von verschiedenen Kompetenzfeldern, die sich zufällig auch noch mit den Interessenslagen der verschiedenen Formen von Akteuren decken, legt unserer Meinung nach die Idee nahe, ein dies berücksichtigendes Zweikammernmodell für die verfasste Studierendenschaft vorzulegen. Darin existieren zwei Kammern – das Studierendenparlament und die Fachschaftskonferenz.
Der Kompetenzrahmen beider Gremien wird von der Satzung gesteckt, sodass die von Kritikern häufig befürchteten „Kompetenzgerangel“ nicht auftreten können – so sind beispielsweise sämtliche Fragen aus dem Bereich der akademischen Selbstverwaltung (Studien- und Prüfungsordnungen, etc.) exklusiv der Fachschaftenkammer (FSK) vorbehalten.
Die FSK stellt in wichtigen Ausschüssen (Schlichtungskommission, Finanzausschuss) ebenso wie das StuPa jeweils zwei Mitglieder, sodass ein
einfaches „überstimmen“ der anderen Kammer nicht möglich ist.
An den Aufgaben des Studierendenparlaments wirkt die FSK insofern mit, als dass sie – wenn sie dies möchte – gegen alle Beschlüsse des Parlaments ein Veto einlegen kann (Ein Veto des Parlaments gegen die FSK existiert hingegen nicht).
Im Zweikammernmodell hat die FSK neben den eben beschriebenen Entscheidungskompetenzen vor allem vernetzende Aufgaben, sie soll ein Forum sein, in dem sich Fachschaftler_innen zu den ihnen wichtigen Themen vernetzen können, in dem sie Ideen zur Gestaltung von Studiengängen austauschen und Strategien zur Durchsetzung studentischer Interessen in ihren Fächern diskutieren können. Dieser Aspekt der Vernetzung kommt nach Aussage vieler FachschaftlerInnen im momentanen Einkammern-U-Modell deutlich zu kurz.
Selbstverständlich gibt es auch in Hochschulgruppen Menschen, die Interesse an Fachschaftsarbeit haben und selbstverständlich gibt es auch in Fachschaften Menschen, die Vorstellungen und Ideen zum Thema Mindestlöhne oder Ökostrom beitragen können und wollen. Die Stärke eines Zweikammernmodells ist, dass dies problemlos möglich ist, aber nicht erzwungen wird – sofern eine Fachschaft gerne über ihre genuinen Aufgabenfelder hinaus in der Parlamentskammer mitwirken möchte, kann sie jederzeit durch Listenwahl Vertreter_innen in das Studierendenparlament schicken. Sie wird jedoch nicht – wie in einem Einkammernmodell zwangsläufig der Fall – hierzu gezwungen.
Letzteres würde dazu führen, dass – wie es aktuell im Ein-Kammern-U-Modell beobachtbar ist – zahlreiche Fachschaften aufgrund des hohen allgemeinpolitischen Anteils der Arbeit schlicht nicht mehr erscheinen, obwohl sie auf Ebene ihres Faches durchaus aktiv sind.
(Bemerkung: Die FSK feierte kürzlich die höchste Beteiligung seit Jahren mit 21 von 50 anwesenden Fachschaften – regulär anwesend sind etwa 10 von 50)
Die Zweikammer-Aufteilung trägt insofern nicht nur dazu bei, politisch Aktive individuell zu entlasten, sondern auch die Motivation und damit das Engagement für die Verfasste Studierendenschaft insgesamt zu erhöhen. Es geht darum, zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen, anstatt von mehr als dreistündigen Mammutsetzungen frustriert zu werden. (Schon in der jetzigen FSK sind sehr lange Sitzungen von bis zu x Stunden keine Seltenheit. Es ist davon auszugehen, dass die Länge der Sitzungen nach Einführung der VS bei einem Ein-Kammer-Modell sogar eher noch größer werden wird.)
Stimmrecht für die Fachschaften
Im Studierendenratsmodell haben Fachschaften mit weniger als 100 Studierenden kein Stimmrecht. Das betrifft nach unserem letzten Stand circa 13 Fachschaften. Das Argument, diese Fachschaften könnten sich zusammenschließen, erscheint uns nicht ausreichend, Fachschaften sollten sich, wenn überhaupt, aus inhaltlichen Gründen zusammenschließen, nicht aus taktischen. Im StuPa/FSK-Modell hat jede Fachschaft unabhängig von ihrer Größe mindestens eine Stimme, was uns deutlich sinnvoller und fairer erscheint.
Struktur und Wahltaktik
Im StuPa/FSK-Modell ist die Größe der Organe so festgelegt, dass diese unserer Erfahrung nach arbeitsfähig bleiben. So hat das StuPa etwa 31 Sitze, was der Größe der Universität angemessen, aber auch nicht zu groß ist. Im Modell des Studierendenrats schwankt die Anzahl der Mitglieder je nach aktuellen Zusammenschlüssen unter der Fachschaften und je nach Wahlbeteiligung zwischen etwa 40 und 80 Mitgliedern. Davon abgesehen, dass ein Gremium aus 80 Personen aus unserer Sicht kaum noch effizient arbeiten kann, halten wir es für außerordentlich problematisch, dass sowohl die absolute Größe des StuRa, als auch seine strukturelle Zusammensetzung (Sitze für Fachschaften vs. Sitze für Hochschulgruppen) sich jedes Jahr derart dramatisch verändern kann.
Autonome Referate
Beide Modelle (StuPa/FSK und StuRa) sehen die Einrichtung sogenannter autonomer Referate vor, die spezielle Themen weisungsungebunden bearbeiten (z.B. ein Referat für chronisch Kranke Studierende und Studierende mit Behinderung oder ein Referat für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung aufgrund kultureller Zuschreibungen).
Diese Referate begrüßen wir sehr. Allerdings gibt es auch hier wieder einen großen Unterschied zwischen den beiden Satzungsmodellen:
Während die autonomen Referate im StuPa/FSK-Modell vollwertige Mitglieder im Vorstand der Studierendenschaft sind, haben sie im StuRa-Modell kein Stimmrecht, sondern dürfen lediglich beratend an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Das halten wir für ein fatales Signal an die von diesen Referaten vertretenen Studierenden. Insofern halten wir auch in diesem Punkt die Regelung des StuPa/FSK-Modells für eindeutig vorteilhafter.
Die Verfasste Studierendenschaft (VS) als
demokratische Interessenvertretung 1945-1977
Bereits in den 1920ern gab es Studentenschaften (StudentINNEN wurden damals nicht erwähnt), welche die demokratische Interessenvertretung der Studierenden in der Weimarer Republik ausüben sollten. Sie waren in der Deutschen Studentenschaft zusammengeschlossen. Diese wurde jedoch in den 1930ern schnell vom nationalsozialistischen deutschen Studentenbund dominiert. Im Zuge der Gleichschaltung im NS-Faschismus ersetzte die Deutsche Studentenschaft ihre einst demokratische Struktur durch das Führerprinzip.
Als die Alliierten 1945 die VS in ihrer modernen Form als demokratische Interessenvertretung der Studierenden einführten, war dies ein Bruch mit dem Führerprinzip und ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung. Studierende sollten, da ihnen später größere gesellschaftliche Verantwortung zukommen würde, demokratische Verhaltensweisen, Meinungsbildung und Interessenvertretung üben. Dazu waren sie mit einem umfassenden politischen Mandat ausgestattet. Die Hochschule wurde als wichtiger Teil der neu aufzubauenden demokratischen Gesellschaft gesehen und eine Äußerung der Studierendenschaft zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen war deshalb erwünscht.
Während kritische Äußerungen des AStA Marburg zum Mauerbau 1961 keinerlei Anstoß in der etablierten Politik hervorriefen, änderte sich dies schlagartig mit der Generation der „1968er“. Sobald die kritischen politischen Äußerungen der VS nicht mehr gegen die Politik des Ostblocks, sondern gegen die BRD-Politik von Notstandsgesetzen bis Schah-Besuch gerichtet waren, wurden Stimmen laut, dass die Studierendenschaft ja überhaupt nichts zu solchen allgemeinpolitischen Dingen sagen dürfe.
Infolge dieser Debatte wurde das Mandat der VS in vielen Bundesländern explizit eingeschränkt. In Berlin wurde die VS bereits 1969 abgeschafft (und Ende der 1970er wiedereingeführt), in Bayern 1973 (bis dato). Baden-Württemberg folgte auf Bestreben des Ex-NS-Marinerichters und CDU-Ministerpräsidenten Filbinger 1977. Dies ging einher mit der Enteignung der Vermögen der Verfassten Studierendenschaften, die dem Land zufielen, und der Übertragung sämtlicher Verwaltungsrechte und Beteiligungen an Wohnheimen, Mensen, Hochschulsport etc. an die Hochschulen und Studentenwerke.
Das Landeshochschulgesetz sah seitdem nunmehr vor, dass der „AStA“ keine eigenständige, rechtsfähige, finanziell unabhängige Interessenvertretung mehr war, sondern nur noch ein studentischer Senatsausschuss mit sportlichem, musischem, kulturellem und eingeschränktem sozialen Mandat. Dieser „AStA“ darf sich nicht einmal zu ureigenen studentischen Angelegenheiten, wie der Einführung des Bachelor und Master Systems, dem BAföG oder dem Semesterticket äußern. Seine Mittel werden nicht von legitimierten Studierenden, sondern von der Hochschulverwaltung verwaltet; jede Ausgabe ist von deren Goodwill abhängig. Außerdem kann er, da er als Ausschuss keine juristische Person ist, keine Verträge abschließen, sodass selbst Einkäufe für Studipartys mit persönlichem Risiko der engagierten Studis verbunden sind.
Die Unabhängigen Modelle als DIY-Interessenvertretung 1977-2012
In Bayern führte die Abschaffung der VS zu einer Entpolitisierung der Studierendenvertretungen – nicht so in Baden-Württemberg. Dort bildeten sich, sobald das Ausmaß der Einschränkungen deutlich wurde, prompt auf eigene Faust unabhängige Modelle („U-Modelle“) der Studierendenvertretung und führten die Arbeit der ehemaligen VS in vollem Umfang weiter.
In der Regel waren diese U-Modelle basisdemokratisch und partizipatorisch ausgerichtet, immer jedoch demokratisch. In Heidelberg war die unabhängige Studierendenvertretung bis zur Wiedereinführung der VS die Fachschaftskonferenz (FSK), doch jede Hochschule in Baden-Württemberg hat ihr eigenes U-Modell, ihren eigenen speziellen Erfordernissen entsprechend. Die U-Modelle bildeten sich schließlich ohne jede gesetzliche Grundlage aus dem politischen Diskurs unter den Studierenden an jeder Hochschule heraus.
Der „Trick“ der U-Modelle ist, dass sie als „U-AStA“ bzw. „FSK“ natürlich jede beliebige Stellungnahme machen konnten, egal ob der gesetzlich verankerte „AStA“ das durfte oder nicht. Ihre Mittel bezogen die unabhängigen Modelle daher, dass sie bei den Senatswahlen eine Mehrheit im gesetzlichen „AStA“ erlangen und dessen Mittel an ihre Strukturen übertragen. So konnte trotz der formalen Einschränkung der demokratischen Mitbestimmungsrechte der Studierenden im Landeshochschulgesetz eine umfassende politische studentische Interessenvertretung über 35 Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Allerdings sind die unabhängigen Studierendenvertretungen einschließlich der FSK formal betrachtet bloß ein beliebiger Haufen Studis und ihre Handlungsmöglichkeiten durch diesen rechtlichen Status stark eingeschränkt. Das hat sich mit der Wiedereinführung der VS in Baden-Württemberg endlich geändert.